09.04.2025
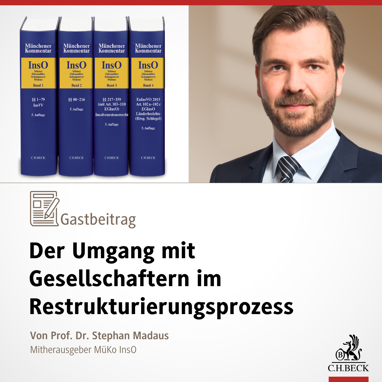
09.04.2025
Deutschlands Wirtschaft schrumpft. Restrukturierungsberater und Insolvenzverwalter sind gefragt. Trotz umfangreicher Regelungen bleiben viele Fragen offen, die weiterhin intensiv diskutiert werden. Prof. Dr. Stephan Madaus, Mitherausgeber des MüKo InsO, beleuchtet einen zentralen Streitpunkt: den Umgang mit Gesellschaftern im Restrukturierungsprozess.
Krisenzeiten sind Blütezeiten des Insolvenzrechts. Kaum eine Branche ist derzeit so ausgelastet wie die der Restrukturierungsberater und Insolvenzverwalter. Der auf die Unternehmen wirkende Transformationsdruck ist hoch. Auch Marktaustritte durch Insolvenzverfahren finden wieder in lange nicht erlebten Dimensionen statt. In Deutschland wird angesichts dieser Umstände für viele Bereiche ein grundlegender Reformbedarf festgestellt und zum Teil die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts hinterfragt.
Deutschland hat ein modernes Restrukturierungsrecht
Ein solcher Nachholbedarf besteht im Bereich des Insolvenz- und Restrukturierungsrechts nicht. Hier wurde die Furcht vor einer Insolvenzwelle infolge der Pandemie genutzt, um gründlich evaluierte Reformen schon 2021 umzusetzen. Seither haben wir in Deutschland ein wettbewerbsfähiges Recht der Unternehmenssanierung. Die in der »Notaufnahme« des Insolvenzverfahrens zur Verfügung stehenden Instrumente zur Unternehmensrettung wurden geschärft, indem gezielte Anpassungen im Recht des Insolvenzplans und der Eigenverwaltung vorgenommen wurden. Zugleich wurde der »ambulante« Bereich erstmals mit effektiven Sanierungshilfen versehen, die es nun ermöglichen, Unternehmen außerhalb eines Insolvenzverfahrens bei der Genesung gerichtlich zu unterstützen. Das StaRUG hat hier die Restrukturierungslandschaft revolutioniert.
Der Umfang der geschilderten Reformen ist nicht zu unterschätzen. Das StaRUG allein hat einen Umfang von über 100 Paragraphen. Es verwundert daher kaum, dass seit der Reform 2021 eine Vielzahl von Kommentaren neu erschienen oder aufgelegt worden ist. Altauflagen dürfen getrost entsorgt werden. Die Regelungsdichte kann natürlich nicht verhindern, dass wesentliche Fragen, die sich in der Restrukturierungspraxis stellen, im Gesetz nicht explizit beantwortet werden und daher streitig diskutiert werden.
Der Umgang mit Gesellschaftern im Restrukturierungsprozess
Ein solcher Streit hat bereits das Bundesverfassungsgericht erreicht und wird mit dem Schlagwort der »kalten Enteignung« von Aktionären durch Restrukturierungsverfahren diskutiert. Er liegt in dem Umstand begründet, dass der Gesetzgeber sowohl bei der Erweiterung der Eingriffsbefugnisse des Insolvenzplans 2012 als auch bei der Schaffung der Eingriffsbefugnisse des StaRUG-Restrukturierungsplans 2021 davon ausging, dass eine rein wertmäßige Betrachtung der Beteiligungsrechte der Gesellschafter angezeigt sei, um dem Umstand der erheblichen Gefährdung von Gläubigerrechten durch Unternehmen in einer Insolvenz(nähe) gerecht zu werden. Dieses Argument erweist sich nun in mehrerer Hinsicht als recht unpräzise.
Der zugrundeliegende Gedanke des Vorrangs der Gläubigerbefriedigung vor jeglichen Ausschüttungen an Gesellschafter erzeugt im Fall einer Liquidation des Gesellschaftsvermögens Verteilungsgerechtigkeit. Er kann aber keine Zuweisung von Entscheidungskompetenzen über die Fortführung des Unternehmens oder dessen künftige Kapitalstruktur rechtfertigen. Hierzu wird darauf verwiesen, dass ein überschuldetes Unternehmen bei wirtschaftlicher Betrachtung seinen Gläubigern gehöre.
Dadurch rückt die Unternehmensbewertung in den Fokus der Betrachtung. Hat das Unternehmen negatives Eigenkapital? In welcher Form ist ein (möglicher, oft erst durch neue Investitionen oder gerichtliche Restrukturierungen erreichbarer) Fortführungswert zu berücksichtigen? Bedarf es eines Markttests, etwa in Form eines ordnungsgemäß durchgeführten Distressed M&A-Prozesses sowie eines Investorenprozesses?
Hält man auf dieser Basis vorrangige Gläubigerkompetenzen für gerechtfertigt, so stellt sich die Frage nach einer gerechten Verteilung der Wertberechtigung am restrukturierten Unternehmen. Können die Gläubiger diesen, potenziell erheblichen Wert unter sich aufteilen oder einem Dritten zuweisen? Inwieweit sind Bezugsrechte der Altgesellschafter relevant?
Auf all diese Fragen gibt das Gesetz nur auslegungsbedürftige Antworten. Sie beschäftigen daher die Gerichte wie auch das Schrifttum in erheblichem Maße. Es bleibt abzuwarten, wie sie höchstrichterlich beantwortet werden.